Kommen wir nach dem grammatischen und dem semantischen Geschlecht zu Geschlechterkategorie Nr. 3 von 4: Das soziale Geschlecht, auch Gender genannt.
Das Englische hat’s gut, denn es unterscheidet zwischen „sex“, also dem biologischen Geschlecht, und „gender“, was sozio-kulturelle und politische Einflüsse beschreibt. Im Deutschen gibt es kein Pendant zu „gender“, weshalb es sinnvoll erscheint, dass das Wörtchen inzwischen auch im Deutschen etabliert ist. Ansonsten würden wir missverständlich immer nur von „Geschlecht“ sprechen. „Geschlecht“ wird aber eher mit dem biologischen Geschlecht assoziiert.
Wir alle sind voller Klischees
Das soziale Geschlecht ist keine sprachliche Kategorie mehr, sondern eine gesellschaftliche und kulturelle Kategorie. Im Mittelpunkt stehen stereotypische Annahmen und Vorstellungen über soziale Rollen, Eigenschaften und Charakterzüge von Männern und Frauen. Diese historisch veränderlichen soziokulturellen Kategorisierungen erlauben Aussagen über unsere Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Übrigens haben wir alle stereotypische Vorstellungen von dem, was angeblich „männlich“ und „weiblich“ ist – ob wir wollen oder nicht. Wir unterscheiden uns nur in dem, wie wir mit Stereotypisierungen umgehen.
Manchen Menschen bringen Stereotype eine gewisse Ordnung in unserer immer komplexeren Welt, in der man nur noch einen Bruchteil des inzwischen vorhandenen Weltwissens besitzen kann. So gesehen sind Stereotype eine gute Sache – Sie vereinfachen die Welt und geben uns Orientierung.
Gefährlich wird es immer dann, wenn es um Entscheidungen geht, die auf stereotypen Annahmen basieren. Wenn also der 8-Jährige Sohn nicht zum Ballett darf, sondern Fußball spielen muss, weil das Jungs halt in dem Alter machen. Oder wenn eine Fußball-Kommentatorin angefeindet wird, weil sie eine Frau ist.
Das Traditionelle hinterfragen
An dieser Stelle unterscheiden wir uns. Es gibt die, die wirklich glauben, dass Fußballspielen naturgegeben „typisch Junge“ oder Ballett „typisch Mädchen“ ist. Und es gibt die, die einen Schritt weiter denken und sich fragen: „Moment mal, ist das wirklich so?“ Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass eine Frau genauso gut ein Fußballspiel kommentieren kann wie ein Mann, auch wenn es sowas – aus welchen Gründen auch immer – noch nicht gab?
Warum dürfen Jungs kein Ballett mögen? Verbietet es ihr Geschlecht oder ist das nicht eher eine Vorstellung in unseren Köpfen, die einfach nur nicht zu unseren Standardbildern von Männern und Frauen passt? Der entscheidende Punkt ist das Sichbewusstmachen (und im besten Fall Aufbrechen) von Stereotypisierungen. Nur dann kann man meiner Meinung nach dem Thema unvoreingenommen gegenüber stehen.
Wer der Meinung ist, dass alle soziokulturellen Erscheinungen, die unser Geschlecht betreffen, mit unserem biologischen Geschlecht zu erklären sind, der muss im Umkehrschluss der Überzeugung sein, dass unser menschliches Miteinander keinerlei Auswirkungen auf uns als Menschen hat. Es ist also demzufolge völlig egal, ob wir im Urwald oder in New York aufwachsen, ob wir im Drogenmilieu oder im wohlbehüteten Elternhaus aufwachsen: Wir sind, was wir sind, wir werden immer der gleiche Mensch sein und daran kann nichts und niemand um uns herum etwas ändern.
Reichlich naive Vorstellung
Dass das Kind im Drogenmilieu eine viel schlechtere Voraussetzung hat als das Kind im wohlbehüteten Elternhaus, scheint demnach keine Rolle zu spielen. Reiner Zufall, dass dieses Kind dann im Regelfall auch ein vermurkstes Leben hat – das muss in seiner DNA zufälligerweise schon so vorprogrammiert gewesen sein.
Für mich ist diese Auffassung reichlich naiv. Unsere Gehirne sind zwar alle einzigartig – niemand hat genau dieselben Denkmuster wie jemand anderes. Sie sind autonom und isoliert. Und trotzdem können wir nicht ohne die anderen Gehirne. Wenn wir miteinander interagieren, einigen wir uns auf gewisse soziale und kulturelle kleinste Nenner. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen unser Gesicht wahren können. Und wir sollten nicht lügen und uns die Hand geben. Es gibt universale Gesten und Mimiken, die wir hierzulande alle verstehen. Schon diese kleinsten Nenner sind Beweis genug, dass uns unsere Gesellschaft formt. Warum sollte sie bei unserer Vorstellung von Geschlecht plötzlich ihre Finger lassen?
Stereotype aus Selbstschutz
Richard David Precht führt einen weiteren dieser kleinsten gemeinsamen Nenner an: Wir wollen uns gut fühlen. Ich denke, da stimmt jeder gesunde Mensch zu. Wir halten uns meistens selbst für die Guten und denken, dass wir moralisch handeln. „Doch eine biologische Theorie, die dieses Bedürfnis nach einer guten Gesinnung erklärt, gibt es nicht“, erklärt Precht. Es tut unserer Psyche gut, dass wir uns mehrheitlich in einer freundlichen Gesellschaft befinden und es tut uns gut, wenn wir verstanden werden. Stereotype spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie helfen uns, schnell verstanden zu werden, weil wir alle sofort wissen, wovon jemand redet.
Für unsere Psyche sind Stereotype also tatsächlich eine gute Sache. Mit Vereinfachungen leben wir sicher angenehmer, vielleicht sogar gesünder. Auf diese Weise verstehen wir die Welt noch. Dann fühlen wir uns gut. Und genau deshalb kann ich es eigentlich auch niemandem verübeln, der oder die sich auf Klischees berufen möchte (die Betonung liegt allerdings auf „eigentlich“, denn für mich überwiegt die negative Seite). So gesehen könnte man behaupten, dass jene, die diese Stereotype von Männlichkeit und Weiblichkeit zu verteidigen versuchen, sich vor allem selbst schützen wollen. Das würde auch erklären, warum sich in der Gender-Debatte viele Menschen so schnell persönlich angegriffen fühlen. Frauen sind Frauen und Männer sind Männer. Punkt. So war es schon immer und so soll es bitte auch bleiben. Niemand hat an diesem schön simplen System zu rütteln!
Es gibt nicht diese eine Definition von Gender
Das Problem bei der Unterscheidung von biologischem und sozialen Geschlecht ist, dass es keine klaren Grenzen gibt. Insofern ist es wenig überraschend, dass über diese Grenzen seit vier Jahrzehnten gestritten wird. Die Wahrheit ist wohl, dass man nie immer nur über die eine oder andere Kategorie sprechen kann. Irgendwie muss man sich immer dem Vorhandensein beider Geschlechterkategorien bewusst sein, weil sich beide gegenseitig bedingen. Wer also denkt, dass „Gender“ das biologische Geschlecht „abschaffen“ will, liegt schon mal falsch. Für die Genderforschung entscheidend ist die Frage, warum Unterscheidungen in Frauen und Männer relevant werden und warum sie wann wie gesellschaftlich bewertet werden.
Versuch einer Einordnung
Wenn man dieser Auffassung folgt, dann ist Gender das Zusammenspiel aus „allem“, also z. B. aus unserer Sprache, aus biologischen Faktoren wie unseren Chromosomenpaaren, unserer Stimmlage, unserer Größe, und aus sozialen Faktoren wie unserer Namensgebung (die in Deutschland eine eindeutige Geschlechtszuordnung erzwingt), unserer Erziehung oder der Kleidung, die wir tragen.
Wichtig ist, dass diese Kategorie keine unveränderliche, natürliche Gegebenheit ist. Frauen und Männer werden in unterschiedlichen Gesellschaften (egal ob geografisch oder historisch) auch unterschiedlich als Frauen und Männer wahrgenommen. Es ist das Ergebnis von Rollenzuschreibungen aus Erwartungen, Normen, Erziehung und Medien. Was in den 50er Jahren das Bild einer Frau war (im Prinzip „Kinder + Herd“), trifft auf unsere Rollenerwartung einer Frau heute schon lange nicht mehr zu.
Die idealistischere und radikalere Definition
Eine etwas radikalere Definition von Gender versucht sich an der Trennung von biologischen und sozialem Geschlecht. Verkürzt gesagt heißt das: Männer und Frauen sind in biologischer Hinsicht unterschiedlich und als soziale Wesen gleich. Würden wir die Kategorisierung in Geschlechter nicht ständig vornehmen, dann wäre Geschlecht gesellschaftlich irrelevanter, als es jetzt ist. Es würde nur dann zum Tragen kommen, wenn es von biologischer Relevanz wäre. Je egaler uns Geschlecht wird, desto näher kämen wir wahrer Gleichberechtigung, so die Hoffnung der VertreterInnen dieser Auffassung. Dann könnte jeder seine eigenen Stärken entwickeln und Wünsche erfüllen – unabhängig von Geschlechterklischees.
Zugegeben, vom heutigen Standpunkt klingt das ziemlich idealistisch. Wir sind weit davon entfernt, wenn wir gerade einmal dabei sind, Frauen genauso viel bei gleicher Arbeit zu zahlen wie Männern. Wir sind aber definitiv auf dem richtigen Weg, das möchte ich ausdrücklich betonen. Spätestens seit der #MeToo-Debatte sind immer mehr Menschen sensibilisiert für Geschlechterthemen. Wenn man Frauen tatsächlich einmal auf Augenhöhe mit Männern begegnen wird, dann wird es uns sicher auch leichter fallen, das Geschlecht einfach mal auszublenden und das zu tun, was wir möchten.
Ich fahre nämlich eigentlich ganz gerne Damenfahrrad.

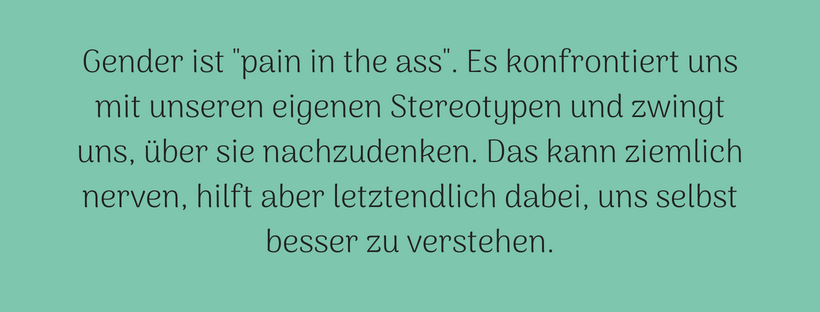
„ … Namensgebung (die in Deutschland eine eindeutige Geschlechtszuordnung erzwingt)“ – Da muss ich dir widersprechen. Es gibt eine ganze Reihe Namen, die aus Deutschland stammen bzw. hier etabliert sind (u.a. auch aus den nordisch-friesischen Sprachraum):
Kai / Kay, Kim, Gerrit, Bente, Robin / Robyn, Mika, Luca, Noa(h), René(e) …
Die Standesämter sind da mittlerweile recht entspannt.