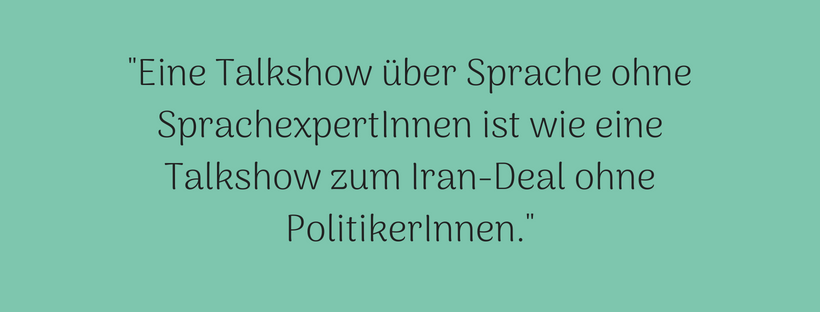Bevor es inhaltlich mit dem semantischen Geschlecht weitergeht, ein kleines Intermezzo. Denn das Team um Maischberger hat es schon wieder getan und anlässlich des Farid Bang- und Kollegah-Skandals beim Echo (RIP) eine Sendung über Sprache veranstaltet. Sinnbildlich lief die Sendung so ab:
Mit dem Titel „Man wird ja wohl noch sagen dürfen!“ greift man zunächst das Totschlagargument all jener auf, die nicht verstehen oder verstehen wollen. Auch bei der desaströsen „Hart aber-fair„-Sendung vor 3 Jahren machte man sich der Rhetorik der notorisch Verunglimpfenden zunutze („Gleichheitswahn“). Aber hey, der Titel muss ja provokant sein.
Sprachliche Gleichberechtigung? Nö, danke.
So spielt man erneut konservativen und rechten Gruppen in die Hände, die Political Correctness – man könnte auch Anstand sagen – infrage stellen und zum Kampfbegriff machen. Eigentlich sollten wir inzwischen an einem Punkt sein, an dem wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob wir andere mit unserer Wortwahl rücksichtsvoll behandeln müssen oder nicht. Eine nicht repräsentative SPON-Umfrage zeigt allerdings einmal mehr, dass das offenbar gar nicht so selbstverständlich ist, wie es uns der gesunde Menschenverstand sagen sollte:

Dass „Gerechtigkeit in der Sprache“ als „Zensur“ aufgefasst wird, macht doch recht deutlich, dass in der Debatte so einiges schief läuft. Also reden wir einmal mehr darüber, was man sagen „darf“ und was nicht. Sprachveränderungen sind in Deutschland ein so sensibles Thema, dass jeder Diskussionsansatz über Veränderungen als Kampfansage interpretiert wird. Zumindest das muss man den Medienmachern hinter Maischberger lassen: Die 2-Lager-Spaltung wissen sie auszunutzen.
Kein Interesse an ernsthafter Auseinandersetzung
Zur Versachlichung fügt man im Titel dann doch noch die Frage hinzu: „Wie diskriminierend ist Sprache?“. Das ist eine gute und wichtige Frage. Doch um eine ernsthafte Auseinandersetzung ist man zum wiederholten Male nicht bemüht. Auch Ali Schwarzer wundert sich, warum offenbar bewusst auf Fachwissen verzichtet wird:
Nicht nur würde die Debatte lebhafter werden, eine solche Diskussion würde endlich auch mal von Fachwissen profitieren. Die ‚Maischberger‘-Redaktion kann mir nicht erzählen, dass sie keine Kontakte hätte.
Wäre man an einer sachlichen Debatte interessiert – sie wäre dringend nötig – würde man vielleicht mal die Wissenschaft fragen – oder, wie Ali Schwarzer schreibt, AktivistInnen und Akteure, „die sich seit Jahrzehnten mit dem diskriminierenden Potential von Sprache auseinandersetzen und sich bewusst dafür entschieden haben, als Akteure in diesem Bereich aufzutreten“. Doch weder WissenschaftlerInnen noch sonstige Akteure werden eingeladen. Dass es eine Sprachwissenschaft überhaupt gibt, scheint in den Köpfen der Macher offenbar gar nicht angekommen zu sein. Meine Erklärung ist: Sprache ist uns zu selbstverständlich, zu banal. Leider ein fataler Trugschluss. Man käme schließlich auch nicht auf die Idee, in einer Talkshow zum Iran-Deal keine PolitikerInnen einzuladen. Dann würde es paradoxerweise auffallen.
Worüber in der Sendung debattiert wurde, waren Wörter, nicht Sprache, wie der Titel suggeriert: N*, Zigeuner, Nutte, Schlampe, Jude – das sind einzelne Wörter. Systematisch um Sprache ging es kaum. Dabei entspräche solch ein Einblick doch mal dem Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Eine historische Sprachwissenschaftlerin hätte zum Beispiel erläutern können, welche Konnotationen (darum geht es letztlich, nicht um die Begriffe selbst) das „N-Wort“ hat und wie sich diese über die Jahrzehnte verändert haben. Oder ob Zigeuner aus sprachwissenschaftlicher Sicht wirklich diskriminierend ist. Oder wie präsent Frauen in unserer Sprache tatsächlich sind. Dann würde man endlich mal den Teufelskreis brechen, sich größtenteils nur Meinungen gegenseitig an den Kopf zu donnern.
Wir müssen lernen, Sprache zu reflektieren
Aus meiner Sicht sind solche Talkshows ein Phänomen – und damit trotz aller Unsachlichkeit hochinteressant. Denn irgendwie sind sie ja doch ein Spiegel der Gesellschaft. So war man sich bei den Fragen, ob man „mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ rappen dürfe oder dunkelhäutige Menschen „N*“ nennen dürfe, überraschend einig (wenn auch nicht komplett): Antisemitismus und Rassismus gehören sich nicht.
So viel scheint beim Großteil der Bevölkerung offenbar angekommen zu sein. Unsere neuere Geschichte hat ja auch recht deutlich gemacht, dass uns das eher in den Abgrund treibt. Als es dann allerdings um unsere Sprache ging, wurde es wieder richtig chaotisch. Sprachliche Gleichstellung – das ist ein Gedanke, der im Vergleich noch relativ jung ist. Das „Nachdenken über Sprache“, die Reflexion von Sprache, ist eine Kompetenz, die in Schulen unter den Tisch fällt und überhaupt noch ziemlich verpönt ist (in manchen Ländern mehr als in anderen).
Verschiedene positive Entwicklungen, wie die Tatsache, dass das N-Wort inzwischen tabu ist oder sich Ehefrauen nicht mehr über ihre Ehemänner definieren müssen, zeigen mir, dass diese Entwicklung eines Tages auch in Sachen geschlechtergerechter Sprache angekommen sein wird. Aktuell sind wir nur noch nicht soweit. Und daher plädiere ich in meinem Blog auch für eine schrittweise Sensibilisierung: Wer gleich mit 100 verschiedenen Geschlechteridentitäten kommt, die sprachlich alle berücksichtigt sein müssen, überfordert 90% der Bevölkerung und stößt auf taube Ohren. Fangen wir doch erstmal mit Mann und Frau an.
Generisches Maskulinum: Wilde Diskussion (fast) ohne Sachverstand
Das versuchte auch „Maischberger“ – und scheiterte kläglich, trotz Teresa Bücker als Gast und Marlies Krämer per Schalte. Bücker legt zwar einen starken Auftakt hin – was man mit rassistischer Sprache gewinne und ob Herr Hahne abends auf dem Sofa säße und weine, weil er bestimmte Wörter nicht mehr sagen dürfe, fragt sie – gibt sich in Sachen frauenfeindlicher Raptexte aber wundersam zurückhaltend, obwohl sie Wörter in Kinderbüchern ändern würde.
Marlies Krämers Ausdrucksweise war leider ziemlich anstrengend und aufmüpfig. Ich persönlich kann sie angesichts des rigorosen Widerstands gegenüber mehr Gerechtigkeit gut verstehen, aber anhand von Bushidos Reaktion merkte man deutlich, wie das bei Skeptikern ankommt – nämlich gar nicht. Zum anderen bringt sie noch im ersten Satz das generische Femininum ins Spiel und überspringt damit so einige Erklärungen, die vorher nötig gewesen wären. Frau Maischberger fragt nach, was das sei. Krämer:
Da sind beide drin, Frau und Mann. Und wenn wir das ‚-in‘ zuhalten, also ‚Sparer–in‘, dann ist der ‚Sparer‘ immer da drin. Und er steht auch noch an erster Stelle. Aber ich bin in dem generischen Maskulinum überhaupt nicht drin. Ich komme da nicht vor.
Soweit so gut, nur wirklich erklärt hat sie das generische Maskulinum und das generische Femininum damit nicht. Gedanklich springt Krämer dann gleich zu sehr weitreichenden Themen wie die Wirtschaftskraft von Frauen.
Kein überzeugendes Interview – vor allem nicht für SprachwissenschaftlerInnen
An dieser Stelle dreht sich die Spirale des Scheiterns immer weiter. Frau Maischberger fragt, warum Frau Krämer die Begründung des Landgerichts in Saarbrücken, „dass das [die Verwendung des generischen Maskulinums] seit 2000 Jahren eben so gemacht wird und die männliche Form eben auch für Frauen steht“ sie nicht überzeuge – eine Frage, die man eigentlich einer/m SprachwissenschaftlerIn hätte stellen müssen. Die Antwort von Frau Krämer ist dementsprechend wenig sprachwissenschaftlich: Die Sprache sei keine 2000 Jahre alt und Banken hätte es damals noch nicht gegeben. Dann pocht sie einfach wieder darauf, dass sie das Recht hätte, sprachlich einbezogen zu werden. Und bäm, Thema abgeschlossen, schon geht es um die Hoch- und Tiefdruckgebiete.
Diskussion ohne Verstand
Maischberger übernimmt wieder – und fährt die Diskussion über das generische Maskulinum komplett gegen die Wand:
Ich probier’s mal gleich hier aus. Wenn Sie [Krämer] sich [vorm Bundesverfassungsgericht] durchsetzen mit dem sogenannten weiblichen Generikum, dann würde ich Sie, Herr Hahne, jetzt vorstellen mit ‚Moderatorin Peter Hahne‘ […] Bushido wäre dann ‚Rapperin Bushido‘.
Das ist leider totaler Bullshit. Ich wunderte mich, dass Frau Krämer nicht widersprochen hat. So etwas kommt heraus, wenn keine Fachexpertise eingeladen ist und die Redaktion nicht ihre Arbeit macht. Die Schauspielerin Mandeng übernimmt Maischbergers Aufgabe und unterscheidet später zwischen direkter und allgemeiner Ansprache. Ein generisches Maskulinum oder generisches Femininum bezieht sich nie auf spezifische Personen, sondern ist eine verallgemeinernde Form, die immer nur eine unspezifische oder unbekannte Gruppe bezeichnet (vgl. Der Kunde Herr Schmidt kauft ein. vs. Der Kunde ist König.).
So viel Differenzierung sollte man jedem zutrauen können. Stattdessen stellt die Maischberger-Redaktion den Diskurs um das generische Maskulinum völlig falsch dar, erklärt es auch nicht und ignoriert die Hintergründe – und erzeugt damit das vorhersehbare Unverständnis: Für Bushido hat Frau Krämer einfach Langeweile. Der Tiefpunkt einer jeden Talkshow.
Wenigstens ein kleiner Höhepunkt
Immerhin versucht Teresa Bücker die Diskussion wieder zurück auf die richtige Bahn zu bringen:
Wenn man Artikel liest, heißt es auch immer ‚Erzieher‘. Das sind in der überwiegenden Mehrheit Frauen. Das ist total absurd, wenn man das liest. Also kann man auch geschlechtergerechte Formulierungen benutzen. […] Wenn man den Spieß umdreht und sagen würde, zur ausgleichenden Gerechtigkeit verwenden wir nur noch das generische Femininum und sprechen nur noch von ‚Journalistinnen‘, von ‚Lehrerinnen‘, von ‚Ärztinnen‘, dann hätten wir die Männer morgen auf den Barrikaden.
Wenn man dem Titel der Sendung hätte gerecht werden wollen, hätte man genau darüber diskutieren sollen – Bücker spricht hier den eigentlichen thematischen Kern der Sendung an (der dann natürlich unbeachtet bleibt). Immerhin erklärt sie anschließend noch den Effekt vom sprachlichen Ausschluss der Frauen. Danke für diese Versachlichung!
„Wir leben in einem Zeitalter des permanenten Geschreis“
Den für mich besten Beitrag bei Maischberger lieferte übrigens der Kabarettist Florian Schroeder. Mit seiner klaren Erläuterung der Logik von Satire anhand Böhmermanns ironisch ummantelten Schmähgedichts und seiner daraus abgeleiteten Beobachtungen analysiert er punktgenau, wie schlecht wir Kunst – und damit auch unsere eigene Sprache – verstehen:
Ich war schockiert, wie wenig wir offenbar im Jahre 2018 in der Lage sind, Anführungszeichen zu lesen – Kunst zu verstehen und Dinge in einen Zusammenhang zu stellen. Stattdessen leben wir in einem Zeitalter des permanenten Geschreis, wo man sich eigentlich freut, wenn man verkürzen kann und die Dinge gar nicht mehr verstehen und in ihrem Zusammenhang verstehen muss.
Peter Hahne illustriert unfreiwillig und deshalb mit großer Zielgenauigkeit, wie recht Florian Schroeder hat: Zigeunerschnitzel, so Peter Hahne, dürfe man sagen, denn es bezeichne ja etwas Positives. Schnitzel ist ja lecker. Hat zwar nix mit dem Begriff „Zigeuner“ zu tun, aber cool! Dann darf die heute-show aber auch Plüschhäschen ans Kreuz nageln. Häschen sind ja süß und Kreuze stehen für das Christentum. Oder? Wer so argumentiert, schneidert sich sich seine Welt zurecht und pickt sich das raus, was ihm oder ihr passt.
Welcome on the other side, Herr Hahne
Über so wenig Empathie und so wenig Reflexionsvermögen kann man nur staunen. „Roma und Sinti? Das bin ich nicht. Also darf man sie ruhig Zigeuner nennen. Aber Häschen am Kreuz? Das tut mir weh.“ Welcome on the other side, Herr Hahne.
Um zum Ursprung dieser misslungenen Sendung zurückzukehren: Das jähe Echo-Ende hat eindrucksvoll bewiesen, wie mächtig Sprache ist. Wir sollten uns endlich ernsthaft mit ihr auseinandersetzen.